Literatur als Reflexion über Wissen
Das Alphazet
Für schriftstellerische Erkundungen erscheint dieses Textformat
aus verschiedenen Gründen interessant:
– Erstens wegen der
Artikelform: Sie motiviert zu einem komprimierenden Schreib- und
Denkstil, zu knappen Formaten zwischen Aphorismus und kurzem Essay.
Eine stilistische Orientierung an jenem Konzept des Fragments, das
Friedrich Schlegel mit dem Bild des ›Igels‹ charakterisiert hat,
liegt zumindest nahe: »Ein Fragment muss gleich einem kleinen
Kunstwerk von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst
vollendet sein wie ein Igel.« (Friedrich Schlegel, KSA II 197) –
– Zweitens wegen der Kontingenz der alphabetischen
Textorganisation: Alles Dargestellte, alle Gedanken und Gegenstände
präsentieren sich in kontingenter Anordnung: am Leitfaden der
willkürlichen Buchstabenreihe. Die ABC-Folge ist nichts als
Konvention – woran das »Alphazet« selbst, und zwar schon im
ersten Artikel, erinnert:
Reihungen am Leitfaden des Alphabets sind entsprechend
antisystematisch und antihierarchisch. Mit dem Wechsel von einer auf
Systematik und Ganzheit zielenden Enzyklopädistik zur alphabetisch
aufgebauten Enzyklopädie ist ein tiefgreifender epistemischer
Einschnitt verknüpft, der – in den Spuren Foucaults (1974) – die
Wissenshistoriker nachhaltig beschäftigt hat, schon weil er
beispielhaft zeigt, wie Epistemen und Schreibweisen einander
wechselseitig prägen (Kilcher 2003). Beides zusammen – die Tendenz
zur Textform des ›Artikels‹ sowie die antisystematische
ABC-Struktur – bedingt die Affinität alphabetischer Schreibweisen
zu einem Denkstil, der sich gegenüber auf Systematik angelegten
Theorien distanziert und kritisch verhält, respektive: der ›Theorie‹
anders als im Sinn von Geschlossenheit und Systematik begreift (Seel
2009). Für die Gegenstände, die sich innerhalb eines alphabetisch
strukturierten Textes verhandeln lassen, gilt Analoges wie für
alphabetische oder alphanumerische Listen: Sie bieten einen Rahmen,
der ›alles Mögliche‹ umspannen kann; sie gestatten, ja
provozieren auch Experimente mit Heterologem. Die berühmte von Jorge
Luis Borges beschriebene, von Foucault zitierte ›chinesische‹
Enzyklopädie existiert zwar nicht, hat aber neben Reflexionen über
Ordnungsvorstellungen und ihre epistemischen Implikationen auch
konkrete Schreibexperimente stimuliert (Jorge Luis Borges: Die
analytische Sprache von John Wilkins. In: Das Eine und die Vielen.
Essays zur Literatur. München 1966, S. 212. Vgl. dazu Michel
Foucault: Die Ordnung der Dinge. Deutsch von Ulrich Köppen.
Frankfurt/M. 1974, 18f.).
– Ein drittes wichtiges Motiv literarischer Experimente mit
der alphabetisch-lexikographischen Form liegt in deren Affinität zum
Kommentieren von Wörtern und zum Nachdenken über diese. Die
Übergänge zwischen Sach- und Wortlexika sind fließend; kein
Lexikon ohne Informationen über Wortbedeutungen, kein Wörterbuch
ohne zumindest ein Minimum an Sachinformation. Die Lemmata eines
Lexikons oder Wörterbuchs sind ›Schlüsselwörter‹: Am Anfang
des jeweiligen Eintrags plaziert, erschließen sie – in
variierender Gewichtung – Wort- und Sachwissen.
– Viertens
lässt sich mit der Entscheidung für das Alphabet als Strukturmodell
von Texten und als Motor einer auf Wörter zentrierten Schreibweise
eine Hommage an die Schriftzeichen verbinden – und damit an die
Elemente der Schrift, als welche die Ausführungen des Textes sich
dem Betrachter konkret präsentieren. Abecedarische Texte
sensibilisieren auch und gerade für die Buchstaben, die da gereiht
erscheinen und Texte, ja die erörterten Dinge selbst, im Gefolge
haben. Walter Benjamin hat zeitgenössische ABC-Fibeln gewürdigt,
die zugleich Buchstaben- und Dingwelten erschließen, und dabei die
Suggestion eines Eigenlebens, einer Eigendynamik der Buchstaben
herausgestellt – vgl. Walter Benjamin, »Aussicht ins Kinderbuch«.
In: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann
Schweppenhäuser , Bd. IV/2 (Frankfurt/M. 1980), 609-613. Ferner:
Gesammelte Schriften III, 267-272 (»Chichleuchlauchra«).
– Fünftens schließlich steht eine Lexikographik, die bei aller
Prägung durch Wissensdiskurse, kritische Haltungen und
philosophisch-essayistische Traditionen doch auch und vor allem als
ein literarisches Projekt wahrgenommen werden will, per se im Zeichen
einer Ambiguität, derentwillen man sie als doppelbödig
charakterisieren könnte: Sie steht zum einen durch ihren Anschluß
an wissensvermittelnde, philosophisch-kritische Diskurse im Zeichen
der Fremdreferenz, widmet sich der Vermittlung von Einsichten über
Gegenstände sowie, gewissermaßen, von Einsichten über Einsichten;
es gibt einen (mindestens) zweifachen Gegenstand: die Welt sowie das
Sprechen und Denken über Welt, wie es der Lexikograph vorfindet.
Diese Bezogenheit auf ›Welt‹ (auf gegenständliche wie auf
diskursive) kann nicht nur theoretische, sondern auch, zumindest
mittelbar und indirekt, praxisrelevante Folgen haben – so wie alle
Kritik. Zum anderen aber verweigert sich literarische Lexikographik
gerade der direkten Funktionalisierung. Sie ist, zumal in ihrer
satirischen Spielform, zwar durch etwas geprägt, das man
behelfsweise ihr ›Ethos‹ nennen könnte, aber dieses ist ein
literarisches Ethos: ein Erproben von Schreibweisen ohne direkten
Zweck, ein Spiel ohne unmittelbare Funktion. Kurz gesagt:
Literarische Lexikographik will aus konträren, aber auch
komplementären Blickwinkeln gelesen werden: sowohl als Exempel eines
Schreibens, das Inhalte vermittelt und sich einmischt – wie auch
als eines, das auf Autonomie beharrt, indem es seine Form in ihrer
ganzen Kontingenz inszeniert.
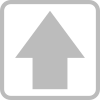
© Iablis (Acta Litterarum) 2010 / 2023
