Literatur als Reflexion über Wissen
Das Alphazet
Vor diesem literarischen Hintergrund nun also das »Alphazet«: kultur- und diskurskritisch, gelegentlich satirisch, spielerisch-konstruktiv, worterfinderisch, alles in allem die Freilegung der Denk- und Schreibphysiognomien seiner Verfasser. Als ein Komplex aus Texten (Artikeln) und Bilden (Bildinitialen) steht es nicht nur in der literarisch-philosophischen Schreibtradition des Dictionnaire, sondern auch in der künstlerischen Tradition der Buchstabenbilder und Bildalphabete (Robert Massin: La lettre et l’image, Paris 1970 / 1993). Ein Maler und ein Maler-Schriftsteller werden vom Alphazet, gleichsam als Doppelgestirn zweier Schutzpatrone, in Erinnerung gerufen: Zum einen Giorgio de Chirico, mit dessen Œuvre sich Paul Mersmann intensiv auseinandergesetzt hat, dem Ulrich Schödlbauer einen Alphazet-Artikel (CHIRICO) widmet und den Paul Mersmann in anderen Artikeln als Künstler würdigt (KITSCH, MALBUTTER – vgl. Ulrich Schödlbauer: Diffusion der Moderne. Paul Mersmann und die Kunst. In: Steffen Dietzsch/Renate Solbach (Hgg.): Paul Mersmann – Diffusion der Moderne, Heidelberg 2008, S. 7-64). Und zum anderen sein Bruder Andrea de Chirico, der sich Alberto Savinio nannte (vgl. den Artikel DUE SAVINII, PER FAVORE).
Literarische Lexikographen äußern sich gern zur gewählten literarischen Form, literarische Lexika kommentieren vielfach ihre eigene Gestalt, deren Motivation, mögliche Verwendungsweisen des Textes und angezielte Effekte. Nicht anders das Alphazet, das wiederholt von sich selber spricht. Es enthält insofern Bausteine zu seiner eigenen Theorie. Nur zu seiner eigenen?
Ulrich Schödlbauers Vorrede zum »Alphazet« enthält eine Poetik in nuce. Das Schreiben – metonymisch repräsentiert durch die »Fingerübungen« der Arbeit am »Alphazet« – wird hier programmatisch als Erkundung und Nutzung der vom Alphabet gebotenen Möglichkeiten charakterisiert. Man muss nicht einmal an die »Bibliothek von Babel« denken, um zu ahnen, was die Einschätzung dieser Möglichkeiten als »beträchtlich« andeutet: Sie sind unerschöpflich. Damit stimulieren sie, so die Anschlussthese, zu einem Schreiben im Zeichen des ständigen Weiter- und Fortlaufens, der Entschränkung, ja des Wettlaufs mit sich selbst, einem Schreiben, das nie zufrieden ist mit dem, was schon vom Zugriff der Beschreibung eingeholt wurde. Solch dauernder Ausgriff auf Neues, ›Nachdrängendes‹ und noch nicht Formuliertes bedingt die Affinität der ›Fingerübungen‹ zum Enzyklopädischen, so die »Vorrede« weiter – zu einem Schreiben also, das die Beschränktheit des Wissens über die Welt als Herausforderung betrachtet, die jeweils gerade bestehenden Schranken jedenfalls in Frage zu stellen (und sie allein dadurch schon hinter sich zu lassen). Ist das Schreiben in diesem Sinn ein sich selbst und das jeweils aktuelle beschränkte Weltwissen immer schon überbietender Parcours »von Umriss zu Umriss«, dann ist im Schreiben als solchem eine ›enzyklopädische‹ Tendenz abgelegt. Anders gesagt: In enzyklopädischen Schreibprojekten kommt mit besonderer Prägnanz zum Ausdruck, was ›Schreiben‹ eigentlich ist: etwas, das immer weitergeht und damit permanent beschriebene ›Welt‹ produziert.
Zum ›Weiterschreiben‹ ermutigt die alphabetische Enzyklopädie, weil sie nie ›fertig‹ ist. Konkret bedeutet dies mit Blick auf ihre alphabetisch organisierten Spielformen, dass sich ein Artikel immer wieder umschreiben, dass sich die Zahl der Artikel selbst aber auch immer wieder erweitern lässt. Innerhalb des Alphabetraums lässt sich immer noch etwas dazwischenschieben.
Gerade enzyklopädische Schreibprojekte als meist kollektive Projekte scheinen nun einer Textproduktionstheorie zuzuarbeiten, die – der im späten 20. Jahrhundert zeitweilig diskursprägenden Diagnose vom ›Tod des Autors‹ entsprechend – den Einzelnen in seiner Schreiberrolle marginalisiert. Die »Alphazet«-Vorrede allerdings warnt davor, hinter allen Texten ein namenloses Kollektiv am Werk zu sehen, auch wenn geläufige Präsentationsformen von Geschriebenem (etwa im Fall nicht namentlich gezeichneter Artikel) dieser Suggestion Vorschub leisten.
Dem Schreibenden, dessen Eigenanteil am Geschriebenen unter Überarbeitungen und Überschreibungen verschwindet, steht der gegenüber, der Spuren gezogen hat, die auf ihn selbst verweisen. Wer solche Spuren hinterlässt, ist damit zwar noch nicht ›präsent‹, er hat für den Leser vielleicht nicht einmal einen Namen (oder allenfalls Initialen). Aber er wird – als einer der dagewesen ist – indirekt wahrnehmbar. Spuren, Abdrücke, indirekte Hinweise, so die Spekulation, wecken vielleicht für den, der da geschrieben hat, ein lebhafteres Interesse als direkte Formen der Selbstinszenierung:
Auf den ersten Blick überraschend, erscheint nun gerade das Lexikonformat als Konstellation nebeneinander geordneter Artikel als ein Ort, an dem der schreibende Einzelne Spuren hinterlassen hat. Alles ›Hintereinander‹ ist nur ein Zufall, nur ein kaschiertes ›Nebeneinander‹. Und was ›nebeneinander‹ zu stehen kommt, zwingt weder dazu, sich schreibend an hierarchischen Begriffen oder kausalen und teleologischen Linearitätsmodellen zu orientieren, noch dazu, dies dem Leser anzusinnen. Gerade durch ihre Indifferenz gegenüber allen vorgegebenen Ordnungsmustern nebst entsprechenden Sinnsuggestionen bietet die Lexikonform (gemeint ist das alphabetische Lexikon) mit ihren Artikeln dem Schreibenden frei disponible Aufnahmebehälter für seine Gedanken und Einfälle. Aus einer solchen Perspektive betrachtet, ist also gerade das lexikographische Schreibprojekt ein Freiraum für den jeweils einzelnen Schreibenden und seine Interessen.
Gewiss – das alphabetische Anordnungsprinzip ist im Zeitalter der Suchmaschinen anachronistisch geworden ist; es bedarf der alphabetischen Sequenzierung nicht mehr, wo sich im Reich der digitalisierten Texte ständig alles mit allem verknüpfen lässt. Gerade darum aber gewinnt die alphabetische Reihenbildung dort, wo sich der Schreibende ihrer dennoch und ›ohne Not‹ bedient, an Signifikanz. Was sie ›besagt‹, ergibt sich, anders gesagt, nicht aus Notwendigkeiten, sondern aus einer bewussten Wahl – vergleichbar der Entscheidung, in einer bestimmten Sprache zu schreiben. Wie es in der Vorrede heißt,
Gerade der anachronistische Charme, der angesichts multipel vernetzter Internetenzyklopädien das alphabetische Lexikon umgibt, macht es zum Modell und zum reizvollen Gegenstand ästhetisch-literarischer Erkundung. Mit dem, was nicht ›sein muss‹, was keinem verbindlich gesetzten Zweck entspricht, kann man spielen.
Das alphabetische Lexikon, schon durch sein konstellatives ›Nebeneinander‹ und seine Disposition zu ständigen Erweiterungen eine dem literarischen Schreiben entgegenkommende Textform, wird als ein Format, das die Ära seiner Zweckmäßigkeit langsam aber sicher hinter sich lässt, auch aus wissens- und medienhistorischer Perspektive zum ästhetisch-literarischen Projekt. Damit lässt sich die Attraktivität des literarisch-essayistischen Spiels mit Lexikonformaten in der jüngeren Literatur erklären, die sich etwa in einem Letzten Lexikon niederschlägt (vgl. Werner Bartens/Martin Halter/Rudolf Walther, Hgg.: Letztes Lexikon. Mit einem Essay zur Epoche der Enzyklopädien, Frankfurt/M 2002) – oder auch in solchen Lexika, die durch die Präsentation anachronistischer Dinge die eigene Geschichtlichkeit mitreflektieren. Das »Alphazet« setzt gezielt auf einen solchen Verfremdungseffekt des ›Überholten‹.
Und noch etwas Weiteres macht das Lexikonformat – nicht nur im »Alphazet« – attraktiv für literarische Denk- und Schreibexperimente: Aus einzelnen Artikeln konstelliert, die jeweils für sich ein Stück ›Welt‹ anbieten, bringt es das ›Weltverhältnis‹ seiner Leser in eine Art Schwebezustand. Es suggeriert nicht, ›Welt‹ als Ganzheit darzustellen, ja es unterläuft sogar die Suggestion, eine solche Ganzheit könne es geben. Es will mehr als nur die ›Eigenwelt‹ eines Einzelnen darstellen, dringt (wie Schreibende und Leser wissen) aber auch nie zu einem vom Subjekt des Wissens unabhängigen, absoluten Wissen vor. Gemessen an den (unrealisierbaren) Ansprüchen der Ganzheit und der Absolutheit erscheint jeder alphabetisch-lexikographische Text, zumal wenn er sich ›Enzyklopädie‹ nennt, als ein in sich gebrochenes Unternehmen: als eine Parodie der Ansprüche, an die er erinnert, um ihnen zu widersprechen. In der »Vorrede« heißt es um Begriff des ›Weltverhältnisses‹:
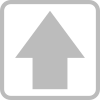
© Iablis (Acta Litterarum) 2010 / 2023
