Über lexikographisches Schreiben als Genre
Die Motive für die Entscheidung, einen Text in Artikel zu alphabetisch aufeinander folgenden Lemmata zu gliedern, sind unterschiedlich; teilweise können mehrere im Spiel sein.
(1) Sammlung und Archivierung. Vor dem diskursiven Hintergrund, der als cultural turn etikettiert worden ist, lässt sich gerade in der Literatur der letzten Jahrzehnte ein zunehmendes Interesse an Bestandsaufnahmen beobachten. Im Kontext einer Kultur, die sich als Erinnerungskultur versteht, gedeihen vor allem lexikographische Darstellungen flüchtiger, vergänglicher, nur temporär bekannter bzw. benutzter Gegenstände; so entstehen Lexika der bedrohten Wörter, Lexika veralteter Dinge, Lexika des Abfalls. Man trägt zusammen, sortiert alphabetisch – und stellt das Gesammelte im Buch als einem Museum der Merkwürdigkeiten, manchmal auch der Absonderlichkeiten aus.
Das Sammeln wird zur Voraussetzung einer (Selbst-)Darstellung der gegenwärtigen Kultur. Listen spielen in der Gegenwartsliteratur eine anhaltend wichtige Rolle; einschlägige Untersuchungen zeigen die Bedeutsamkeit der Listenform für die Literaturen verschiedener Zeiten und Sprachräume (Mainberger); Umberto Eco hat rezent dem Thema Listen eine Darstellung gewidmet, die neben verbalen auch pikturale Listen umfasst (Eco 2009). Die alphabetische Anordnung des Gesammelten und Aufgelisteten ist ein Modus der Strukturierung, mit dem bewusst auf die Suggestion einer sachlichen Systematik und Hierarchisierung verzichtet wird. Das Alphabet ist egalitär, demokratisch: Es bringt Verschiedenartiges in eine Reihenfolge, die allein den Namen folgt; eine Ordnung der Wörter tritt an die Stelle einer (suggerierten) Ordnung der Dinge. Profitieren lässt sich zudem von den Be- und Verfremdungseffekten, die sich ergeben können, wenn sich dabei eigenartige Nachbarschaftsverhältnisse erheben.
(2) Partikularisierung. Im Bereich des autobiographischen Schreibens ist die alphabetisch-lexikographische Form unter anderem deshalb von Interesse, weil sie ein Alternativmodell zur chronologischen Ordnung anbietet. Wenn Alberto Savinio, Carlos Fuentes, Czesław Miłosz und Roland Barthes über sich selbst am Leitfaden des Alphabets schreiben und artikelweise über Erfahrungen, über ihnen persönlich wichtige Themen und Einsichten, über das eigene Erleben im engeren und weiteren Sinn sprechen, so verbindet sich damit bedingt durch die gewählte Form automatisch ein Moment der Partikularisierung. Es gibt keinen Zwang zur ganzen Geschichte mehr, weil man an ganze Geschichten nicht mehr glaubt. Es gibt keinen Zwang zur Vollständigkeit mehr, weil man an Vollständigkeit, an erschöpfende Darstellungen nicht mehr glaubt. Eine rein alphabetische Ordnung, so der Hintergedanke, ist besser als die falsche Suggestion einer absoluten Ordnung. Eine partikuläre und partikularisierende Darstellung ist immerhin eine Darstellung: in ihrer Punktualität ein Hinweis darauf, dass sich Erlebtes, Erfahrenes, Leben selbst dem Zugriff zu weiten Teilen entzieht.
(3) Suggestionen kompetenter Überschau. Was »von A bis Z« präsentiert wird, scheint – einer anderen Semantisierung zufolge – aber auch wieder ›erschöpfend‹ und ›panoramatisch‹ dargestellt zu werden. Die ganze Alphabetreihe scheint zu verheißen, dass ein ›ganzer‹ Wissensbestand (oder zumindest alles relevante Wissen) mitgeteilt wird, wenngleich in Einzelsegmenten. Wenn beispielsweise die alphabetische Form im Bereich des (auto-)biographischen Schreibens gewählt wird, kann sich damit allerdings auch eine andere, tendenziell gegenläufige Suggestion verbunden, die ebenfalls ein Effekt der Orientierung an lexikographischen Schreibweisen ist: die Suggestion eines enzyklopädischen Gedanken‑, Erfahrungs‑ oder Wissensbestandes, eines großen Rundumschlags, einer panoramatischen Bilanz. Gisela Dischners »Wörterbuch des Müßiggängers« scheint es auf diese Suggestion anzulegen, insofern hier die erörterten Themen betont aus der Distanz des Müßiggängers‹ erörtert werden, und Distanz ist ja zumindest eine erste Voraussetzung für Überschau. Ob man den Gestus überzeugend findet, sei dahingestellt.
(4) Ästhetisierung von Wissensdiskursen. Die Verwendung alphabetischer Formen kann ein Moment der Ästhetisierung sein: Formen, die nicht notwendig gewählt werden, machen auf sich aufmerksam. Wer also ein Sachbuch als alphabetisches Lexikon aufmacht, wo auch eine an sachlichen Aspekten orientierte Struktur denkbar gewesen wäre, macht seine Darstellung zu einem Arrangement, das seine ästhetische Dimension unbeschadet seines Informationswerts hervorhebt. (Ein Beispiel bietet ein originelles Lexikon über das »Pfeifen im Walde« von 1994.) Hier bietet sich insbesondere die Möglichkeit zur Darstellung von Heterogenem, zur Kombination unterschiedlicher Wissensbestände und -diskurse.
(5) Weltschöpfung. Wo ein Lexikon, eine Enzyklopädie (oder auch ein Reiseführer, eine Chronik, ein Sprachführer etc.) ist, die eine Welt beschreiben, da muß auch eine Welt sein: auf diese tlönianisch inspirierte Suggestion setzen Autoren, die sich der Ausstattung imaginärer Welten widmen, indem sie lexikographisch deren Bewohner, deren Topographien, deren Flora und Fauna, deren Gebräuche, Wissensinhalte, Krankheiten, Spielregeln, etc. beschreiben. Tolkien ist musterbildend, viele andere sind seinen Spuren gefolgt; Fantasy-Welten werden vielfach lexikographiert (nicht nur solche, die in Büchern beschrieben sind, sondern z. B. auch die Welten von Rollenspielen. Verwandt damit sind Spiele mit der Grenze von Realität und Fiktion, wie sie etwa betrieben werden, wo Lexika erfundener Dichter, erfundener Künstler, erfundener Bücher, erfundener Krankheiten etc. entstehen: Hier wird Imaginäres behandelt, als handle es sich um konventionell lexikographierbare Realien.
(6) V-Effekte. Die Verwendung lexikographischer Formen führt zur Aufmerksamkeit auf die Form an sich sowie – in Verbindung damit – zur Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Form und Inhalt. Satiren, Parodien sowie humoristische Texte, deren Primärziel statt ernsthafter Kritik die Verulkung ihres jeweiligen Gegenstandes ist, beziehen daraus ihre Effekte. Schriftsteller in Gestalt einer lexikographisch dargestellten Dichterflora vorzustellen, ist ebenso wie die Präsentation eines literarischen Bestiariums ein Verfahren, über die verfremdende Darstellungsform humoristische oder satirische Wirkungen zu erzielen.
(7) Sprachreflexion. Zwischen Sach- und Fachlexika und Wörterbüchern verläuft keine klare Grenze, weder sachlich noch begrifflich; ein »Dictionnaire« kann Sachinformationen bieten, ein Sachlexikon informiert vielfach auch über Terminologien, Ausdrucksweisen, Etymologien. Darum bietet die lexikographische Form nicht zuletzt Anlaß zur Reflexion über Wörter, zur Suche nach und zur Erkundung von Ausdrucksweisen, zum Spiel mit Namen und Formulierungen – und zur Reflexion über Sprachliches, seinen Gebrauch, seine Wirkungen.
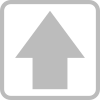
© Iablis (Acta Litterarum) 2010 / 2023
