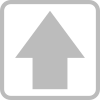Konzepte und Implikationen
Die Aufgabe der Buchführung über das menschliche Leben kann nicht nur bei himmlischen (jenseitigen) Instanzen liegen, sondern auch in den Händen des Menschen selbst. Auch der Mensch, der das Leben eines anderen Menschen oder das eigene Leben beschreibt, möchte, daß der Beschriebene nicht vergessen wird. Und auch mit fremd- oder selbstbiographischen Projekten verbindet sich vielfach die Idee einer Rechtfertigung – vor dem Himmel, vor der Nachwelt und vor den Menschen oder auch vor sich selbst. Schon die ägyptischen Grabinschriften – oft von den später Verstorbenen selbst zu Lebzeiten verfaßt – wurden als erste »Autobiographien« charakterisiert, da sie diese Funktion der Selbstrechtfertigung haben. (Vgl. dazu Assmann 1983, 64ff.) Wer sein Leben beschreibt, möchte dieses erinnerbar halten, aber auch reflektieren und kommentieren. Indem das Leben zum Buch wird, soll es verständlich werden. Die Autobiographie scheint außerdem oftmals Anlaß zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst und einer daraus resultierenden Selbsterkenntnis zu sein. Michel de Montaigne vertritt diesen Anspruch auf programmatische Weise, auch wenn er mit den »Essais« im engeren Sinne keine Biographie schreibt; er betrachtet sein autobiographisches Werk, die Aufzeichnung seiner Gedanken, als Darstellung seines Wesens.